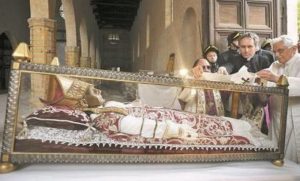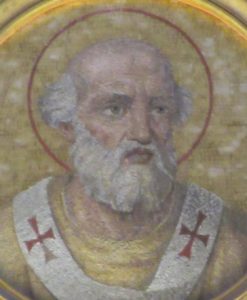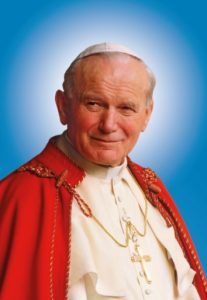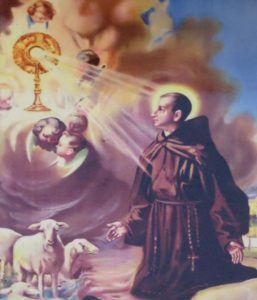Der Heilige Geist wird euch alles lehren
[…] das schauende Leben ist ein himmlisches Leben […] [Dank der Liebeseinheit mit Gott] wächst der Mensch über seine Geschaffenheit hinaus und findet und kostet den Reichtum und die Wonne, die Gott selber ist, und die Gott ohne Unterlass ausgießt in der Verborgenheit des Geistes, durch den der Mensch der Edelheit Gottes gleicht. Sobald der innige, schauende Mensch derart sein ewiges Bild erreicht hat und in dieser Lauterkeit durch den Sohn eingegangen ist in den Schoss des Vaters, so ist er mit göttlicher Wahrheit erleuchtet […] Ihr müsst wissen, dass der himmlische Vater als ein lebendiger Grund mit allem, was in ihm lebt, seinem Sohne, als seiner eigenen, ewigen Weisheit, tätig zugewandt ist. Und dieselbe Weisheit und alles, was in ihr lebt, ist wiederum dem Vater, das heißt demselben Grunde, aus dem er hervorgeht, tätig zugewandt. Und in dieser Begegnung geht die dritte Person zwischen dem Vater und dem Sohne hervor, nämlich der Heilige Geist, die Liebe beider, die mit beiden eins ist in [ein und] derselben Natur. Und dieser umfängt und durchdringt wirkend und genießend den Vater und den Sohn und alles, was in ihnen beiden lebt, mit so großem Reichtum und solcher Freude, dass alle Kreatur hierüber ewiglich schweigen muss. Denn das unbegreifliche Wunder, das in dieser Liebe liegt, das übersteigt ewiglich das Verständnis aller Geschöpfe. Aber wo man dieses Wunder ohne Staunen versteht und kostet, da ist der Geist sich selbst entrückt und eins mit Gottes Geist und kostet und sieht ohne Maß gleich Gott den Reichtum, der Gott selber ist, in der Einheit des lebendigen Grundes, wo er sich nach der Weise seiner Ungeschaffenheit besitzt. Nun wird diese glückselige Begegnung in uns nach der Weise Gottes ohne Aufhören tätig erneuert […] Denn gleichwie der Vater ohne Aufhören in der Geburt seines Sohnes alles aufs neue schaut, so werden alle Dinge in der Ausströmung des Heiligen Geistes vom Vater und Sohne aufs neue geliebt. Und das ist die tätige Begegnung des Vaters und des Sohnes, darin wir minniglich [liebevoll] umfangen werden durch den Heiligen Geist in ewiger Liebe.
Quelle: CFM.SCJ Archiv Alexandria