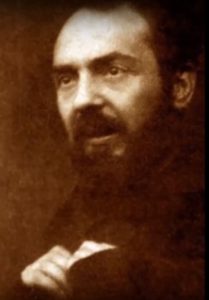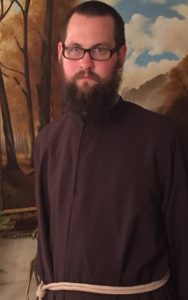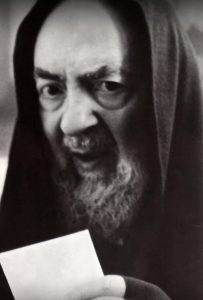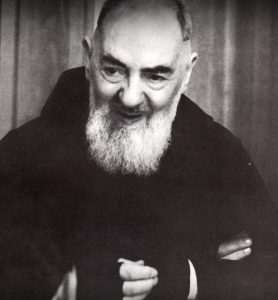Von Rechtsanwalt René Udwari
Benedikt XVI. versetzt Moderne Theologie und seine Vorgänger in Rotation
Er hat es schon wieder getan. Er ist alt, emeritiert, längst „abgeschrieben“ und noch immer rührt er sich. Noch immer publiziert er, längst im Ruhestand und außer Dienst, kontrovers zu Themen, die den Neu-Theologen und Feuilletonisten Europas und Nordamerikas heilige Kühe sind. Und moduliert, für einen „Mozart der Theologie“ eigentlich schon viel zu alt, vorsichtig und behutsam die Begriffe und Schlüsse der modernen Theologie, um sie nahezu unbemerkt in die Richtung der katholischen Theologie aller Zeiten zu schubsen.
Es scheint, als ob Papa emeritus Benedikt XVI. seine journalistischen und theologischen Widersacher in Schrecken versetzt. Gefährlich sei es, unter Ratzingers theologischen Konstruktionen als Theologenkollege hindurchzuschreiten, raunt es aus dem bergischen Off.
Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ muss ihn mittlerweile entweder für heiligmäßig oder für den Leibhaftigen halten. Sie traut ihm jedenfalls Wunder zu. Denn nach Ansicht ihres Kommentators ist es Benedikt XVI. zu verdanken, dass sein heimgegangener Vorgänger im Petrusamt nun im Grab rotiere (FAZ vom 18.7.2018). Die Ruhe an der Grabstelle in der St.-Sebastian-Kapelle des Petersdomes ergibt jedoch, dass der Kommentator hier metaphorisch zum Ausdruck bringen wollte, dass Johannes Paul II. sicher nicht einverstanden gewesen wäre mit einem Text seines Nachfolgers, der in diesem Sommer in der theologischen Zeitschrift „Communio“ veröffentlicht wurde.
Benedikt XVI. setzt sich in dem Text mit dem Verhältnis von katholischer Kirche und Judentum auseinander. Der Aufsatz nimmt kritisch die katholische Position zum jüdisch-christlichen Verhältnis und deren Begründung auf katholischer Seite auseinander, so wie sich beide in der Zeit nach der Erklärung Nostra Aetate entwickelt haben.
Wie bereits nach der Zulassung der Karfreitagsfürbitte im römischen Ritus ist weniger der Inhalt des Aufsatzes, sondern vielmehr die Person Benedikts XVI. selbst unter Beschuss. Theologen und Journalisten sind auf der Pirsch, um den Papst, der im Paradiesgarten des interreligiösen Dialogs wildern gegangen ist, zur Strecke zu bringen. Es nützt ihm nichts, dass er jetzt und früher schon den Antisemitismus ausdrücklich verdammt und mit dem christlichen Glauben für unvereinbar erklärt hat. Es nützt ihm nichts, dass er nur Nuancen in den theologischen Sätzen, die das katholische Verständnis des Verhältnisses von Kirche und Judentum definieren, anders beurteilt. Diese Nuancen streben zu der von Benedikt XVI. propagierten „Hermeneutik der Kontinuität,“ die in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils die ununterbrochene Fortsetzung der katholischen Lehrtradition sehen will.
Ob und inwieweit dies überhaupt denkbar ist, ist innerhalb der verschiedenen theologischen Positionen umstritten. Wer diese Kontinuität behauptet, muss die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gewachsenen Texte aber auch an die beständige Lehre, dass „außerhalb der Kirche kein Heil“ besteht, anknüpfen können. Denn immerhin hat das Konzil von Florenz 1441 den schon von dem Heiligen Cyprian von Karthago (gest. 258) geprägten Satz zum Dogma erhoben. Das darf also als katholische Tradition gelten. Seither wird dieses Dogma wenigstens so verstanden, dass im Himmel alle katholisch sind, dass also auch Nicht-Katholiken wenigsten im allerletzten Moment Ihres Lebens dem dreifaltigen Gott, den die Kirche verkündet, und vor allem „Christus, dem Retter aller Menschen“ (so wie es die geschmähte Neufassung der Karfreitagsfürbitte formuliert) gegenüberstehen und sich für oder gegen ihn entscheiden.
Alles anders und vor allem besser?
Wer die Aussagen des Zweiten Vatikanische Konzils als Bruch mit der Tradition deutet, der kann freilich die These aufstellen, dass insbesondere mit der durch Papst Paul VI. verkündeten Erklärung Nostra Aetate im Verhältnis der Kirche zu anderen Religionsgemeinschaften mit einem Schlag alles anders und vor allem besser geworden sei. Hinsichtlich des Judentums würdigt diese Erklärung die Gemeinsamkeiten zwischen den Heiligen Schriften beider Religionen und enthält die Aussage, dass man die Juden allgemein nicht als „verworfen“ bezeichnen dürfe.
Papst Johannes Paul II. sprach später von einem „nie gekündigten Bund“ Gottes mit dem Volk Israel. Dieses Wort legt die Messlatte für kirchliche Diskussion zum jüdisch-katholischen Dialog hoch. Darauf hat sich als Stück der neu-theologischen Allgemeinbildung der Satz entwickelt, dass die Kirche nicht, wie früher häufig vertreten, den Sinai-Bund Gottes mit Israel abgelöst habe.
Dass Vertreter des Judentums auf diese Messlatte nicht verzichten wollen und darauf beharren, dass die Kirche über dieses Stöckchen springt, ist nicht verwunderlich. Erwarten nicht auch Katholiken von jedwedem Bischof, dass er von anderen Religionsgemeinschaften Rücksichtnahme fordert und den Glauben gegenüber den Lehren dieser anderen Religionen als wahr behauptet? Die, teils auch lautstarke und polemische, Kritik an dem Text von Seiten des Judentums ist daher als Teilnahme an einem echten Dialog, in dem beiden Seiten ihre Meinung mitteilen, deutlich zu begrüßen. Verwunderlich sind die Reaktionen auf Seiten der Theologen, die Benedikt XVI. nun wieder einmal des Antisemitismus bezichtigen.
Unschärfe der bisherigen Diskussion
Mit seinem Aufsatz zum Verhältnis von Kirche und Judentum bleibt Benedikt XVI. auf dem Boden dieser „Allgemeinbildung,“ wenn er sich hinter die These stellt, dass Israel nicht durch die Kirche als neuen Bund Gottes mit den Menschen ersetzt wurde. Er kritisiert jedoch die Unschärfe der bisherigen Diskussion und des Gebrauch der Begrifflichkeiten. Er merkt an, dass die moderne Theologie eine frühere, „vorkonziliare“ Substitutionstheorie behauptet, die sich als einheitliche Lehre und unter diesem Begriff aber nicht nachweisen lasse.
Der Begriff des „nie gekündigten Bundes“ zwischen Gott und den Juden sei ebenfalls zu undifferenziert für den theologischen Gebrauch und müsse geschärft werden. Der Aufsatz erwähnt auch die Tempelzerstörung und die Diaspora der Juden. Katholische Theologen nehmen nun zum Anlass, hieraus die Fundamente einer christlichen Rechtfertigung des Antisemitismus zu lesen. Blind sei Benedikt XVI. gegenüber der „Ideologiegeschichte“ seiner Kirche, so Gregor Maria Hoff. Als sei die Kirche ein Weltanschaulicher Verein, der an einer Ideologie bastele. Diese Argumentation wird weder der Person des angegriffenen noch dem Wesen der Theologie gerecht.
Sicher ist die Standortbestimmung für die katholische Kirche in ihrem Verhältnis zum Judentum in der öffentlichen Debatte nicht einfach, da Grob-Historiker und anti-kirchlich eingestellte Meinungsmacher mit wohlfeiler Vereinfachung sämtliches Unrecht, dass Juden in christlichen Gesellschaften durch christliche Laien und durch weltliche Autoritäten widerfahren ist der Kirche anlasten, bis hin zum Judenhass der Nationalsozialisten.
Die Sorge einiger Theologen, dass negative Aussagen des kirchlichen Lehramts über das Judentum an sich dem Hass auf einzelne Menschen oder Menschengruppen Vorschub leisten könnten, ist einerseits anhand der historischen Tatsachen verständlich. Andererseits ist nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar, warum katholische Theologen nicht deutlich die kirchliche Verdammung der Gewalt gegen Juden unterstreichen und stattdessen katholische Aussagen zur Abgrenzung von Glaubensinhalten in beiden Religionen in einen Topf schmeißen mit rassistischem Gedankengut und Menschenhass. Es ist unverständlich, weshalb Geschichtsforschung und Überlegungen zur Heilsgeschichte miteinander vermengt werden. Der Vorwurf an Text Benedikts XVI., genau dies getan zu haben, als er die Einschränkungen des „nie gekündigten Bundes“ in Zusammenhang mit Diaspora und Tempel erwähnt, fällt also auf seine Kritiker zurück.
Dem Verständnis, warum die theologische Ebene für die Kritik an Benedikt XVI. nicht ausreicht, mag der Gedanke nachhelfen, dass es hier nur vordergründig um ein konkretes, heikles theologisches Detail geht und dass im Hintergrund vielmehr der Relativismus und katholische Theologie im Ganzen miteinander ringen.
Man muss noch nicht einmal zur Frage, wie die Kirche zum Judentum steht und wie Katholiken sich gegenüber Juden verhalten sollen (Stichwort: „Judenmission“) gelangen, um Zeuge dieses Ringkampfes zu sein. Schon bei der Frage, für wie verbindlich die Kirche den katholischen Glauben hält („extra ecclesia salus non est„) würde Benedikt der XVI. nach in den Augen seiner Kritiker seine Amtsvorgänger seit Paul VI. im Grab rotieren lassen. Da sei es schon verwerflich, als Christ und Katholik Gottes Bund mit Israel mit Fokus auf Christus zu deuten. Theologische Giganten wie Michael Böhnke sitzen zu Gericht und stempeln Ratzinger zum theologischen Zwerg, weil seine Dogmatik nicht „im Dienst der Versöhnung“ steht.
Dass der katholische Glaube die Versöhnung des Menschen mit Gott verkündet, und dass die Kirche diese Versöhnung zuerst anstreben muss, bevor man über Dialog und Versöhnung mit anderen Religionsgemeinschaften nachdenkt, ist bei diesem Urteilsspruch unerheblich. Erheblich und Maßstab sollen „der Geist des Konzils“ und „der christlich-jüdische Dialog“ sein. Eine Anknüpfung an die katholische Lehrtradition und überhaupt nur die Suche nach ihr darf es daher nicht geben. „Teuflisch“ sei Ratzingers wirken daher, urteilt der selbsternannte Richter Böhnke.
Solche Pamphlete entziehen sich einer sachlichen Kritik. Interessant wird stattdessen sein, ob die wissenschaftlich fundierte und sachlich vorgetragene Kritik, die auf Schwachstellen in der Argumentation Benedikts XVI. hinweist und gleichzeitig die progressive Auslegung der Erklärung Nostra Aetatevorantreiben will (z.B. Pater Christian Rutishauser SJ), tonangebend bleibt oder ob sich weitere Stimmen unter den Theologen mit Benedikt auf die Suche nach der Harmonie der Tradition begeben. Das gäbe der Verständigung zwischen katholischer Kirche und Judentum die Chance, zu einem spannenden Dialog zu werden, in dem sich tatsächlich beide Seiten etwas zu sagen haben. Es wäre auch die Chance, innerhalb der Theologie einen echten Dialog über Bruch und Kontinuität anzustellen.
Quelle: catholicnewsagency Bild: Screens. CFM.SCJ Archiv Yaoundé