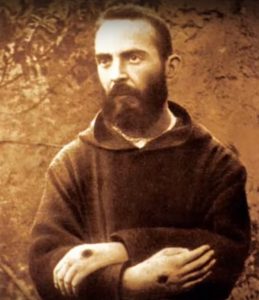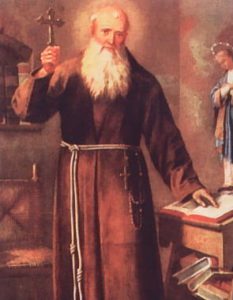Lehrerin bricht Schweigen zu radikalem Islam an Schulen
Buch sorgt schon vor Veröffentlichung für politischen Wirbel.
Wien. Susanne Wiesinger, Lehrerin an einer Neuen Mittelschule in Wien-Favoriten bricht ihr Schweigen über radikalen Islam an Schulen. Am Montag erscheint ihr neues Buch zum Thema „Kulturkampf im Klassenzimmer“. Sie erzählt darin ihre Erlebnisse an der Schule vor allem nach den Anschlägen auf „Charlie Hebdo“ in Paris 2015. In ihrer Klasse gab es mehrere muslimische Schüler, die die Attentäter feierten, so Wiesinger.
„Islam das Wichtigste in ihrem Leben“
Religiöse Gebote und Verbote würden das Denken dieser muslimischen Schüler beherrschen. Islam sei für sie das Wichtigste in ihrem Leben geworden, schreibt Wiesinger in der „Kleinen Zeitung“.
Viele muslimische Schüler gehorchten ihrem Glauben. Alles andere müsse sich unterordnen. „Die Religion hatte unsere Schule im Griff“, so Wiesinger, die weiterschreibt, dass die Lehrer an der Wiener Schule mit der Situation nach den Anschlägen in Paris überfordert waren.
„Wollen mit unserer Kultur nichts zu tun haben“
„Das ging so weit, dass diese Schüler mit unserer Kultur nichts zu tun haben wollten, sie hassten und sie immer mehr auch aktiv bekämpfen wollten. So wie die „Charlie Hebdo“-Terroristen, die genau deswegen von ihnen bewundert wurden“, schreibt Wiesinger in der „Kleinen Zeitung“.
„Es ist zu stark. Wir sind zu schwach“
Lehrer würden vor dem religiösen Gedankengut resignieren. „Es ist zu stark. Wir sind zu schwach“, sagten sich einige Pädagogen, die in einer völlig anderen Welt leben würden als ihre muslimischen Schüler, so Wiesinger.
„Natürlich gab es Beispiele gelungener Integration. Man konzentrierte sich allerdings nur auf diese und übersah dabei die immer größer werdenden Brennpunkte“, schildert sie weiter.
Politischer Wirbel um Buch
Das aktuelle Buch über Integrationsprobleme muslimischer Schüler an österreichischen Schulen hat am Sonntag für heftige Reaktionen aus der ÖVP und der FPÖ geführt. Beide Parteien warfen der rot-grünen Wiener Stadtregierung Versagen vor. Das Thema wurde auch in der ORF-„Pressestunde“ mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) diskutiert.
Susanne Wiesinger, eine Wiener Lehrerin an einer Neuen Mittelschule, spricht schon seit einigen Monaten öffentlich über die Integrationsprobleme an Wiener Schulen. Nun hat sie darüber ein Buch mit dem Titel „Kulturkampf im Klassenzimmer“ geschrieben. Darin berichtet sie u.a. von Beschneidungen und muslimischen Mädchen, die von ihren Mitschülern bedroht werden, wenn sie sich nicht angemessen kleiden.
ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sprach von einem „erschütternden Tatsachenbericht“. „Radikalisierung und muslimische Parallelwelten sind Realität“, die Schilderungen der Wiener Lehrerin „zeigen ein gefährliches Sittenbild“. Er forderte die Wiener Stadtpolitik auf, hier „endlich aufzuräumen“.
„Schleichende Islamisierung“
„Die schleichende Islamisierung in Wiens Klassenzimmern ist keine stille und heimliche, sondern eine mit Pauken und Trompeten vonstattengehende. Nur der Stadtschulrat und die rot-grüne Stadtregierung möchten davon nichts wissen bzw. verschließen davor die Augen“, kritisierte auch FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss und appellierte an die Stadtregierung, „diesen Hilferuf endlich ernst zu nehmen“ und einen runden Tisch zu diesem Thema einzuberufen.
„Die undifferenzierte rot-grüne Willkommenskultur trägt nun ihre Früchte. Radikalisierung und islamische Parallelwelten sind in Wiens Klassenzimmern längst angekommen und werden von Rot-Grün nach wie vor ignoriert und schöngeredet“, attestierte auch ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch.
Quelle: oe24.at Bild: APA/dpa/Monika Skolimowska