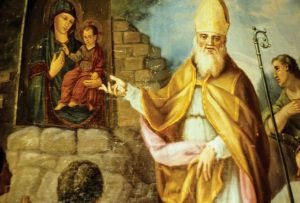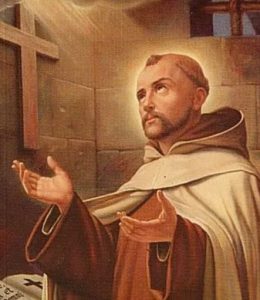„Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft“
Johannes hat nicht nur zu seiner Zeit gesprochen, als er den Pharisäern den Herrn verkündet hat, wenn er sagte: „Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen!“ (Mt 3,3). Heute erschallt sein Ruf in uns, und der Donner seiner Stimme erschüttert die Wüste unserer Sünden […] Seine Stimme hallt noch heute wider und ruft: „Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen!“ […] Er fordert uns auf, den Weg für den Herrn vorzubereiten – nicht dadurch, dass wir eine Straße bauen – sondern durch die Reinheit unseres Glaubens. Der Herr ergreift nicht die Wege dieser Erde, vielmehr dringt er bis in die Tiefe des Herzens vor. Wenn dieser Weg irgendetwas Rohes in den Sitten, etwas Hartes in unserer Grobheit, etwas Schmutziges in unserem Verhalten aufweist, so sollen wir es reinigen, begradigen, einebnen. So wird der Herr bei seinem Kommen, anstatt zu stolpern, einen Weg vorfinden, der von Keuschheit geprägt ist, durch den Glauben geebnet ist und mit unseren Almosen geschmückt wurde. Der Herr hat die Gewohnheit, auf einem solchen Weg voranzuschreiten, denn der Prophet sagt: „[…] bringet seinem Namen ein Loblied; bereitet dem Bahn, der heraufzieht über den Sonnenuntergang! Herr ist sein Name!“ (Ps 68(67),5 Vulg.). […] Johannes selbst hat seinen Weg für das Kommen Christi in vollkommener Weise verfolgt und geordnet, denn er war in allem bescheiden, demütig, arm und jungfräulich. „Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften; Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung“ (Mt 3,4). Was ist ein größeres Zeichen der Demut, als die Verachtung weicher Kleider, anstelle derer man sich mit rauem Fell kleidet? Was ist ein tieferes Zeichen des Glaubens, als immer mit gegürteten Hüften bereit zu sein für die Pflichten des Dienstes? Welches Zeichen des Verzichts wäre strahlender, als sich von Heuschrecken zu ernähren und von wildem Honig?
Papst Benedikt XVI. über den heiligen Bischof Maximus von Turin
Liebe Brüder und Schwestern!
Zwischen dem Ende des vierten und dem Beginn des fünften Jahrhunderts trug nach dem heiligen Ambrosius ein anderer Kirchenvater entscheidend zur Verbreitung und Festigung des Christentums in Norditalien bei: Es handelt sich um den heiligen Maximus, dem wir 398, einem Jahr nach dem Tod des Ambrosius, als Bischof von Turin begegnen. Die Nachrichten über ihn sind sehr spärlich; dafür ist auf uns eine Sammlung von ungefähr 90 seiner Predigten gekommen. Aus ihnen wird jene tiefe und lebendige Bande des Bischofs mit seiner Stadt ersichtlich, das einen offensichtlichen Berührungspunkt zwischen dem bischöflichen Dienst des Ambrosius und jenem des Maximus bezeugt.
In jener Zeit störten schwere Spannungen die Ordnung des zivilen Zusammenlebens. Maximus gelang es in diesem Kontext, das Christenvolk als Hirte und Lehrer um seine Person zu sammeln. Die Stadt war der Bedrohung zerstreuter Barbarengruppen ausgesetzt, die über die östlichen Grenzen eingedrungen waren und bis zu den Westalpen vorrückten. Aus diesem Grund war Turin ständig von Militärgarnisonen besetzt und wurde in den kritischen Momenten zur Zufluchtsstätte der flüchtenden Bevölkerung des Umlandes sowie der Städte, denen es an Schutz mangelte. Die Interventionen des Maximus angesichts dieser Situation bezeugen sein Engagement, um auf den zivilen Niedergang und Zusammenbruch zu antworten. Ist es auch schwierig, die soziale Herkunft der Adressaten der Predigten zu bestimmen, so scheint es, dass die Predigt des Maximus – um die Gefahr der Verallgemeinerung zu überwinden – sich in spezifischer Weise an einen auserwählten Kern der christlichen Gemeinde von Turin richtete, der sich aus reichen Landbesitzern zusammensetzte, die ihre Besitzungen im Turiner Umland und ihre Häuser in der Stadt hatten. Es war dies eine eindeutige pastorale Wahl des Bischofs, der in dieser Art der Predigt den wirksamsten Weg erkannte, um seine Bande mit dem Volk aufrechtzuerhalten und zu stärken.
Um in dieser Perspektive das Amt des Maximus in seiner Stadt zu erläutern, möchte ich als Beispiel die Predigten Nr. 17 und 18 heranziehen, die einem stets aktuellen Thema gewidmet sind: dem des Reichtums und der Armut in den christlichen Gemeinden. Auch in dieser Hinsicht wurde die Stadt von schweren Spannungen erschüttert. Die Reichtümer wurden angehäuft und verborgen gehalten.
In der folgenden 18. Predigt prangert Maximus das wiederholte Vorkommen von Plünderungen auf dem Rücken des Unglücks der anderen an. „Sag mir, Christ“, so redet der Bischof seine Gläubigen an, „sag mir: Warum hast du die von den Räubern hinterlassene Beute an dich genommen? Warum hast du einen zerfleischten und besudelten ‚Gewinn‘ in dein Haus eingebracht?“ – „Vielleicht aber“, so fährt er fort, „gibst du vor, gekauft zu haben, und meinst deshalb, der Anklage des Geizes zu entgehen. Nicht so aber kann der Kauf mit dem Verkauf vereinbart werden. Es ist gut zu kaufen, aber in Friedenszeiten, was frei verkäuflich ist, nicht während einer Plünderung, was geraubt worden ist… Es handelt also als Christ und Bürger, wer kauft, um zurückzuerstatten.“ (Predigt 18,3).
Ohne es zu sehr erkennen zu lassen, kommt Maximus so dazu, eine tiefe Beziehung zwischen den Pflichten des Christen und denen des Bürgers zu predigen. In seinen Augen bedeutet ein Leben als Christ auch, bürgerliche Verpflichtungen zu übernehmen. Umgekehrt gilt: Jeder Christ, der „trotz der Möglichkeit, von seiner Arbeit zu leben, die Beute des anderen mit der Raserei von wilden Tieren an sich reisst“; der „seinen Nachbarn bedrängt“ und „jeden Tag die Grenzen des anderen übertreten, sich der Erzeugnisse bemächtigen will“, scheint ihm nicht einmal mehr nur dem Fuchs ähnlich zu sein, der die Hühner abschlachtet, sondern dem Wolf, der sich auf die Schweine stürzt (Predigt 41,4).
Im Vergleich zur vorsichtigen Verteidigungshaltung, die Ambrosius zur Rechtfertigung seiner berühmten Initiative zum Loskauf der Kriegsgefangenen an den Tag legte, treten deutlich die geschichtlichen Veränderungen hervor, die sich in der Beziehung zwischen dem Bischof und den Institutionen der Stadt eingestellt hatten. Da er nunmehr durch eine Gesetzgebung unterstützt wurde, die die Christen dazu anspornte, die Gefangenen loszukaufen, fühlte sich Maximus angesichts des Zusammenbruchs der zivilen Autoritäten des Römischen Reiches völlig dazu ermächtigt, in diesem Sinne eine wahre Kontrollmacht über die Stadt auszuüben. Diese Macht sollte dann immer weiter und wirksamer werden, bis zu dem Punkt, dass sie die Abwesenheit der Beamten und der zivilen Institutionen ersetzte. In diesem Kontext setzt sich Maximus nicht nur dafür ein, um in den Gläubigen die traditionelle Liebe zur Vaterstadt wieder aufflammen zu lassen, sondern er verkündet auch die konkrete Pflicht, die Steuerlast auf sich zu nehmen, so schwer und unbeliebt diese auch erscheinen mag (Predigt 26,2).
Also, der Ton und der Inhalt der Predigten setzen ein gewachsenes Bewusstsein für die politische Verantwortlichkeit des Bischofs in den spezifischen geschichtlichen Umständen voraus. Er ist der in die Stadt gesetzte „Späher“. Wer sollten denn sonst diese Späher sein, fragt sich nämlich Maximus in der Predigt 91, „wenn nicht die seligsten Bischöfe, die zur Verteidigung der Völker gewissermassen auf ein hohes Bollwerk der Weisheit gestellt worden sind und so von Ferne die ankommenden Übel sehen?“
Und in der Predigt 89 erklärt der Bischof von Turin den Gläubigen ihre Aufgaben, und bedient sich dabei eines einzigartigen Vergleichs zwischen der Funktion des Bischofs und der der Bienen: „Wie die Biene“, sagt er, „achten die Bischöfe auf die Keuschheit des Leibes, reichen die Speise des himmlischen Lebens, gebrauchen den Stachel des Gesetzes. Sie sind rein, um zu heiligen; süss, um zu stärken; streng, um zu strafen.“ So beschreibt der heilige Maximus die Aufgabe des Bischofs zu seiner Zeit.
Die historische und literarische Analyse beweist also ein wachsendes Bewusstsein der politischen Verantwortung der kirchlichen Autorität in einem Kontext, in dem sie de facto an die Stelle der zivilen Autorität trat. Dies ist tatsächlich die Entwicklungslinie des Bischofsamtes in Nordwestitalien seit Eusebius, der „wie ein Mönch“ in seinem Vercelli wohnte, bis zu Maximus von Turin, der als „Wache“ auf die höchste Festung der Stadt gestellt war.
Es ist offensichtlich, dass der geschichtliche, kulturelle und soziale Kontext heute vollkommen anders ist. Der heutige Kontext ist vielmehr der, dessen Grundriss mein verehrter Vorgänger Papst Johannes Paul II. im Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Ecclesia in Europa anlegte, wo er eine differenzierte Analyse der Herausforderungen und hoffnungsvollen Zeichen für die Kirche in Europa heute bietet (6-22). In jedem Fall bleiben trotz der veränderten Situationen die Pflichten des Gläubigen gegenüber seiner Stadt und seinem Vaterland immer gültig. Die Verwobenheit der Pflichten des „ehrlichen Bürgers“ mit denen des „guten Christen“ hat mitnichten an Bedeutung eingebüsst.
Zum Schluss möchte ich an das erinnern, was die Pastoralkonstitution Gaudium et spes sagt, um einen der wichtigsten Aspekte der Lebenseinheit des Christen zu erhellen: die Kohärenz zwischen Glauben und Verhalten, zwischen Evangelium und Kultur.
Das Konzil fordert die Gläubigen auf, „nach treuer Erfüllung ihrer irdischen Pflichten zu streben, und dies im Geist des Evangeliums. Die Wahrheit verfehlen die, die im Bewusstsein, hier keine bleibende Stätte zu haben, sondern die künftige zu suchen, darum meinen, sie könnten ihre irdischen Pflichten vernachlässigen, und so verkennen, dass sie, nach Massgabe der jedem zuteil gewordenen Berufung, gerade durch den Glauben selbst um so mehr zu deren Erfüllung verpflichtet sind“ (43).
Folgen wir dem Lehramt des heiligen Maximus und vieler anderer Väter, und machen wir uns den Wunsch des Konzils zu Eigen, auf dass die Gläubigen immer mehr „ihre menschlichen, häuslichen, beruflichen, wissenschaftlichen oder technischen Anstrengungen mit den religiösen Werten zu einer lebendigen Synthese verbinden (wollen); wenn diese Werte nämlich die letzte Sinngebung bestimmen, wird alles auf Gottes Ehre hingeordnet“ und somit auf das Wohl der Menschheit.
Quelle & Bild: CFM.SCJ Archiv Cairo