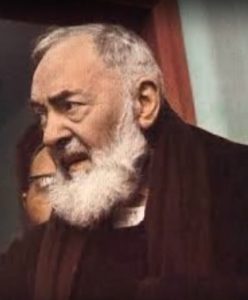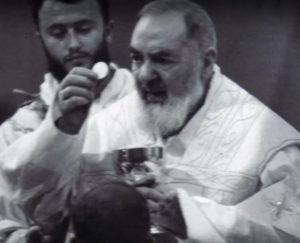Konvertiten fordern Ende der Islamisierung
Konvertiten, ehemalige Muslime, die Christen wurden, haben an Papst Franziskus einen leidenschaftlichen Appell gerichtet, der den ganzen Westen angeht. Sie fordern das Ende der Islamisierung und von Papst Franziskus, die Förderung dieser Islamisierung einzustellen.
(Rom) Eine Gruppe von Konvertiten, die sich vom Islam zum katholischen Glauben bekehrt haben, haben einen dramatischen Appell an Papst Franziskus gerichtet. Sie kritisieren eine „naive und gefährliche Haltung“ gegenüber dem Islam. Sie fordern ein Ende der Islamisierung des Westens und von Papst Franziskus, daß er die Förderung dieser Islamisierung beenden solle. Die Sache sei sehr ernst, denn es gehe „um eine Frage von Leben und Tod“.
Die ökumenischen und interreligiösen Anstrengungen des Vatikans und von Teilen der katholischen Kirche haben sich in den vergangenen Jahren, durch die massive Einwanderung aus islamischen Staaten, noch verstärkt. Erzbischof Luigi Negri kritisierte vor wenigen Tagen, daß man um Weihnachten den Eindruck gewinnen konnte, „als würden wir das Fest des Migranten und nicht die Geburt Christi feiern“.
Verfechter dieser Anstrengungen versichern dagegen, daß dadurch die Integrität der Glaubenswahrheit weder in Frage gestellt noch gefährdet werde.
„Es gibt aber noch ein mögliches Opfer, von dem nicht gesprochen wird“, so Carlos Esteban von InfoVaticana.
Gemeint sind die Konvertiten aus dem Islam bzw. jene Muslime, die ernsthaft eine Konversion zur katholischen Kirche beabsichtigen.
Keine Antwort aus Santa Marta auf den Appell
Fördert Papst Franziskus die Islamisierung?
In den vergangenen Tagen wurde Papst Franziskus der Appell einer Gruppe von Konvertiten übermittelt, der von 3.000 Personen unterzeichnet wurde. Er wurde von den ehemaligen Muslimen bereits am Weihnachtsfest veröffentlicht, aber bisher von den „Leitmedien“ ignoriert. Genau dieses Verhalten, dieses Wegschauen, ist der Grund des Appells in dem Papst Franziskus eine „sehr einfache Frage“ gestellt wird, so InfoVaticana:
„Warum riskiert man buchstäblich das Leben, um katholisch zu werden, wenn der Islam ‚an sich eine gute Religion ist‘, wie der Papst zu lehren scheint?
Bis jetzt gab es auf die Frage keine Reaktion aus Santa Marta, „obwohl sie sehr relevant ist“, so InfoVaticana. Doch das kenne man schon „von den Dubia und der Correctio filialis“. Die Frage, so Esteban, betreffe zwar nicht nur den Islam, sei aber für muslimische Konvertiten besonders dramatisch.
Alle führenden koranischen Rechtsschulen fordern für Apostasie vom Islam die Todesstrafe. Es gibt aus jüngster Zeit genügend Beispiele, die belegen, daß es sich dabei nicht um eine bloß theoretische Forderung handelt, die nur in der Vergangenheit exekutiert wurde. Der Koran (Sure 8.89, 8.7–11) schreibt den Tod des Apostaten vor. Mitten in Europa finden Taufen von Muslimen häufig nur im Verborgenen und unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt.
Die Konvertiten fragen deshalb Papst Franziskus, mit Blick auf verschiedene Aussagen des Kirchenoberhauptes:
„Wie ist es möglich, die Gewalt des Islams mit der Gewalt einzelner Christen gleichzusetzen?“
An Papst Franziskus: „Wir können Sie nicht verstehen“
Im Appell heißt es weiter:
„Ihnen gefällt es nicht, um den heißen Brei zu reden, und uns auch nicht, deshalb erlauben wir uns, Ihnen zu sagen, daß wir Ihre Lehre über den Islam, wie man sie in Evangelii gaudium Nr. 252 und 253 lesen kann, nicht verstehen, weil sie nicht berücksichtigt, daß der Islam NACH Christus kam, und nur der Antichrist sein kann (vgl. 1 Joh 2,22)“.
Was schreibt der Lieblingsjünger des Herrn im Ersten Brief des Johannes?
„Wer ist der Lügner – wenn nicht der, der leugnet, daß Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist: wer den Vater und den Sohn leugnet.“
Als ehemalige Muslime erklären die Autoren des Appells über ausreichend Kenntnis des Islams und der katholischen Glaubenslehre zu verfügen, um sagen zu können, daß eine Vereinbarkeit von Kirche und Islam eine Illusion sei. Dazu zitieren sie verschiedene Stellen aus dem Koran.
Der Islam sei ebenso unvereinbar mit dem katholischen Glauben, so die Konvertiten, wie der Nationalsozialismus und der Kommunismus.
„Die Naivität gegenüber dem Islam ist selbstmörderisch und sehr gefährlich.“
Konvertiten verlassen Kirche wieder, „angewidert von der Feigheit“
Taufe von Magdi Allam durch Benedikt XVI.
„Ist es nicht besorgniserregend, daß der Papst den Koran als Heilsweg anzuerkennen scheint? Sollen wir denn zum Islam zurückkehren?“
Die Unterzeichner spielen aber nicht nur auf die Zweideutigkeit in den Worten von Papst Franziskus an, wenn er über den Islam spricht. Sie beklagen auch seine „Fahrlässigkeit“, die Anhänger Mohammeds nicht „nach Hause“, zur Bekehrung zu rufen.
„Das islamophile Reden Eurer Heiligkeit veranlassen uns, zu beklagen, daß die Muslime nicht aufgefordert werden, den Islam zu verlassen, und daß viele ehemalige Muslime, wie Magdi Allam, die Kirche wieder verlassen: angewidert von der Feigheit, verletzt von zweideutigen Gesten, verwirrt von der mangelnden Evangelisierung und empört vom Lob für den Islam… Auf diese Weise gehen die unwissenden Seelen in die Irre.“
Eine „Frage von Leben und Tod“
Erzbischof Nona Amel
Neben den Gefahren für das ewige Seelenheil sprechen die Konvertiten in ihrem Appell auch die physischen Gefahren heute und jetzt an, denen die Konvertiten durch „die irenische und naive Haltung des Vatikans gegenüber dem Islam“ ausgesetzt seien. Diese konkreten Gefahren für Leib und Leben betreffen zwar besonders die Konvertiten, aber nicht nur, sondern „alle Christen“, weil sie „nicht auf eine Konfrontation mit dem Islam“ vorbereitet werden.
Dazu zitieren sie unter anderem Wort des chaldäisch-katholischen Erzbischofs von Mosul, Nona Amel, von 2014:
„Unser derzeitiges Leiden ist das Vorspiel dessen, was ihr europäischen und westlichen Christen in naher Zukunft erleiden werdet. […] Ihr nehmt in euren Ländern eine wachsende Zahl von Muslimen auf. Auch ihr seid in Gefahr. Ihr müßt entschiedene und mutige Entscheidungen treffen. Ihr glaubt, daß alle Menschen gleich sind, aber der Islam sagt nicht, daß alle Menschen gleich sind. Wenn ihr das nicht bald begreift, werdet ihr zu Opfern des Feindes, den ihr selbst in euer Haus eingeladen habt.“
Die Unterzeichner des Appells an Papst Franziskus sprechen von einer Frage „von Leben und Tod“. Jede Selbstzufriedenheit gegenüber dem Islam sei „Verrat“.
An Papst Franziskus gewandt heißt es:
„Wir wollen nicht, daß der Westen mit der Islamisierung fortfährt, und auch nicht, daß Ihr Handeln dazu beiträgt. Wohin sollten wir dann gehen, um Zuflucht zu finden?“
Quelle: katholisches.info Bild: Screens.