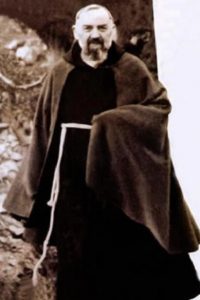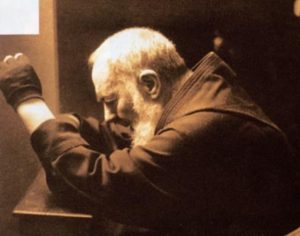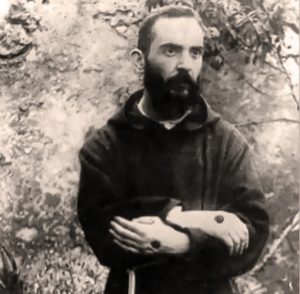(Rom) „Die Multiplikation der Rechte führt letzten Endes zur Zerstörung des Rechtsbegriffs und endet in einem nihilistischen „Recht“ des Menschen, sich selbst zu verneinen – Abtreibung, Suizid, Produktion des Menschen als Sache werden zu Rechten des Menschen, die ihn zugleich verneinen.“
Am heutigen Montag, 14. Mai 2018, erscheint weltweit der neue Band „Die Freiheit befreien – Glaube und Politik im dritten Jahrtausend“ mit politischen Texten und Reden des Theologen Joseph Ratzinger und späteren Papstes Benedikt XVI.. In Italien ist er seit dem vorhergehenden Donnerstag im Handel. Die deutschsprachige Fassung wird vom Verlag Herder herausgegeben. Das Vorwort verfasste Papst Franziskus.
Der Band enthält auch einen bisher unveröffentlichten Text, der das Datum vom 10. Oktober 2014 trägt. Darin betont Benedikt XVI. die Bedeutung des Glaubens an Gott für die Weise, wie der Mensch und seine Rechte gefasst werden.
Den Aufsatz „Die Multiplikation der Rechte und die Zerstörung des Rechtsbegriffs“ (definitiver Titel) hatte Benedikt XVI. in Reaktion auf ein Buch des italienischen Philosophen und Politikers Marcello Pera verfasst. In dessen Buch „Kirche, Menschenrechte und die Abkehr von Gott“ habe Pera seine Sicht auf die Geschichte des Liberalismus geändert:
„Mir kommt vor, dass Sie in Ihrem Buch ‚Perché dobbiamo dirci cristiani’ den Gottesgedanken der großen Liberalen anders werten als in Ihrem neuen Werk. In Ihrem neuen Opus erscheint er schon wesentlich als ein Schritt auf den Verlust des Glaubens an Gott hin.
In Ihrem ersten Buch hingegen hatten Sie für mich überzeugend dargestellt, dass der europäische Liberalismus ohne den Gottesgedanken un-verständlich und unlogisch ist. Für die Väter des Liberalismus war Gott noch Grundlage ihrer Sicht von Welt und Mensch, so dass nach diesem Buch die Logik des Liberalismus gerade das Bekenntnis zu dem Gott des christlichen Glaubens notwendig macht.
Ich verstehe, dass beide Wertungen begründet sind. Einerseits löst sich im Liberalismus der Gottesbegriff von seinen biblischen Grundlagen und verliert so langsam seine konkrete Kraft. Andererseits bleibt Gott für die großen Liberalen doch noch unverzichtbar. Man kann die eine oder andere Seite des Vorgangs stärker betonen. Ich denke, man muss sie beide nennen. Aber die Vision Ihres ersten Buches bleibt für mich unverzichtbar, dass nämlich der Liberalismus seine eigene Grundlage verliert, wenn er Gott auslässt“.
Die Multiplikation der Rechte und die Zerstörung des Rechtsbegriffs. Elemente zur Diskussion des Buches von Marcello Pera „La Chiesa, i diritti umani e il distacco da Dio“ („Kirche, Menschenrechte und die Abkehr von Gott“)
Vatikanstadt
10.10.2014
Zweifellos ist Ihr Buch eine große Herausforderung an das gegenwärtige Denken, besonders auch an Kirche und Theologie. Der Hiatus zwischen den Aussagen der Päpste des 19. Jahrhunderts und der mit „Pacem in terris“ beginnenden neuen Sicht ist offenkundig und viel beredet. Er gehört ja auch zum Kernbestand des Widerspruchs von Lefèbvre und seinen Anhängern dem Konzil gegenüber. Ich fühle mich nicht imstande, eine klare Antwort auf die Problematik Ihres Buches zu geben, sondern kann nur einige Gesichtspunkte notieren, die nach meinem Dafürhalten für die weitere Debatte wichtig sein könnten.
1. Erst durch Ihr Buch ist mir klar geworden, wie sehr mit „Pacem in terris“ eine neue Richtung beginnt. Ich war mir bewusst, wie stark die Wirkung auf die italienische Politik gewesen ist, in der diese Enzyklika den entscheidenden Anstoß für die Öffnung der Democrazia Cristiana nach links gegeben hat. Ich war mir aber nicht bewusst, wie sehr sie auch in den Grundlagen ihres Denkens einen neuen Ansatz bedeutet. Dennoch hat nach meiner Erinnerung die Frage der Menschen-rechte erst durch Papst Johannes Paul II. praktisch ihren hohen Stellenwert im Lehramt und in der nachkonziliaren Theologie erhalten. Mein Eindruck ist, dass dies bei dem heiligen Papst weniger Ergebnis einer Reflexion war (die freilich bei ihm nicht fehlte), sondern Konsequenz einer praktischen Erfahrung. Gegenüber dem Totalitätsanspruch des marxistischen Staates und seiner ihn gründenden Ideologie sah er als die konkrete Waffe den Gedanken der Menschenrechte an, der die Totalität des Staates begrenzt und damit den nötigen Freiraum nicht nur für persönliches Denken, sondern vor allem auch für den Glauben der Christen und die Rechte der Kirche bietet.
Die säkulare Figur der Menschenrechte, wie sie 1948 formuliert worden waren, erschien ihm offensichtlich als die rationale Gegenkraft gegenüber dem alles umfassenden ideologischen und praktischen Anspruch des marxistisch begründeten Staates. So hat er als Papst das Anliegen der Menschenrechte als eine von der allgemeinen Vernunft anerkannte Macht weltweit gegen Diktaturen aller Art eingesetzt. Dieser Einsatz galt nun nicht mehr nur atheistischen Diktaturen, sondern auch religiös begründeten Staaten, wie sie uns vor allem in der islamischen Welt begegnen.
Der Verschmelzung von Politik und Religion im Islam, die notwendig die Freiheit anderer Religionen, so auch der Christen, einschränkt, wird die Freiheit des Glaubens entgegengestellt, die nun in gewissem Maß auch den laikalen Staat als richtige Staatsform ansieht, in der die Freiheit des Glaubens Platz findet, auf die die Christen von Anfang an Anspruch erhoben haben. Johannes Paul II. wusste sich dabei gerade auch in innerer Kontinuität mit der werdenden Kirche. Sie stand einem Staat gegenüber, der zwar religiöse Toleranz durchaus kannte, aber eine letzte Identifikation von staatlicher und göttlicher Autorität festhielt, der die Christen nicht zustimmen konnten. Der christliche Glaube, der eine universale Religion für alle Menschen verkündet, schloss damit notwendig eine grundsätzliche Begrenzung der Staatsautorität durch Recht und Pflicht des einzelnen Gewissens ein. Dabei wurde zwar nicht der Gedanke von Menschenrechten formuliert.
Es ging vielmehr darum, den Gehorsam des Menschen Gott gegenüber als Grenze dem Staatsgehorsam entgegenzustellen. Aber mir scheint, daß es nicht unberechtigt ist, die Gehorsamspflicht des Menschen Gott gegenüber als Recht dem Staat gegenüber zu formulieren, und insofern war es wohl durchaus logisch, wenn Johannes Paul II. in der christlichen Relativierung des Staates für die Freiheit des Gehorsams Gott gegenüber ein Menschenrecht ausgedrückt fand, das jeder staatlichen Autorität voraus liegt. In diesem Sinn konnte der Papst nach meinem Dafürhalten durchaus eine innere Kontinuität des Grundgedankens der Menschenrechte mit der christlichen Überlieferung behaupten, auch wenn die sprachlichen und gedanklichen Instrumente weit auseinander liegen.
2. Nach meinem Dafürhalten ist in der Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen in der Sache enthalten, was Kant ausgedrückt hat, wenn er den Menschen als Zweck und nicht als Mittel bezeichnet. Man könnte auch sagen, es sei enthalten, dass der Mensch Rechtssubjekt und nicht nur Rechtsobjekt ist. In Gen 9,5f kommt dieser elementare Grundbestand der Menschenrechtsidee, wie mir scheint, deutlich zum Ausdruck: „… Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn: Als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht.“ Die Gottebenbildlichkeit des Menschen schließt ein, dass sein Leben unter dem besonderen Schutz Gottes steht – dass er vor menschlichen Rechtssetzungen Träger eines von Gott selbst gesetzten Rechtes ist.
Diese Ansicht hat zu Beginn der Neuzeit bei der Entdeckung Amerikas grundlegende Bedeutung gewonnen. Da all die neu entdeckten Völker nicht getauft waren, erhob sich die Frage, ob sie überhaupt irgendwelche Rechte hätten. Zu eigentlichen Rechtssubjekten wurden sie nach der herrschenden Meinung erst durch die Taufe. Die Erkenntnis, dass sie von der Schöpfung her Ebenbild Gottes waren und auch nach der Erbsünde blieben, bedeutete zugleich die Einsicht, dass sie auch vor der Taufe schon Rechtssubjekte waren und Anspruch auf die Achtung ihres Menschseins erheben durften. Mir scheint, das hier „Menschenrechte“ erkannt wurden, die der Annahme des christlichen Glaubens und jeder wie auch immer gearteten staatlichen Macht voraus liegen.
Wenn ich recht sehe, hat Johannes Paul II. sein Engagement für die Menschenrechte in Kontinuität mit der Haltung der alten Kirche dem römischen Staat gegenüber verstanden. Tatsächlich hatte der Auftrag des Herrn, alle Völker zu seinen Schülern zu machen, eine neue Situation im Verhältnis zwischen Religion und Staat geschaffen. Eine Religion mit Universalitätsanspruch gab es bis dahin nicht. Die Religion war ein wesentlicher Teil der Identität der jeweiligen Gesellschaft.
Der Auftrag Jesu bedeutet unmittelbar nicht das Verlangen nach einer Änderung in der Struktur der einzelnen Gesellschaften. Aber er verlangt, dass in allen Gesellschaften die Möglichkeit offen bleibt, seine Botschaft anzuerkennen und nach ihr zu leben. Damit ist zunächst vor allem das Wesen der Religion neu definiert: Sie ist nicht Ritus und Observanz, die letztlich die Identität des Staates garantiert. Sie ist vielmehr Erkenntnis (Glaube), und zwar Erkenntnis von Wahrheit. Da der menschliche Geist auf die Wahrheit hin geschaffen ist, ist es klar, dass Wahrheit verpflichtet, aber nicht im Sinn einer positivistischen Pflichtethik, sondern von ihrem Wesen her und dass sie gerade so den Menschen frei macht.
Diese Verbindung von Religion und Wahrheit schließt ein Freiheitsrecht ein, das man in einer inneren Kontinuität mit dem wahren Kern der Menschenrechtslehre sehen darf, wie Johannes Paul II. es offensichtlich getan hat.
3. Sie haben mit Recht die augustinische Idee von Staat und Ge-schichte grundlegend dargestellt und zur Basis Ihrer Sicht der christlichen Staatslehre gemacht. Vielleicht hätte aber auch die aristotelische Vision noch mehr Beachtung verdient. Soweit ich sehen kann, ist sie im Mittelalter allerdings in der kirchlichen Tradition kaum zum Tragen gekommen, vor allem nachdem ihre Aufnahme durch Marsillius von Padua in Widerspruch mit dem kirchlichen Lehramt geraten war. Um so mehr ist sie dann seit dem 19. Jahrhundert in der sich entfaltenden katholischen Soziallehre aufgegriffen worden. Man geht nun von einem doppelten Ordo aus – dem Ordo naturalis und dem Ordo supernaturalis -, wobei der Ordo naturalis als in sich komplett betrachtet wird. Man betont ausdrücklich, dass der Ordo supernaturalis frei hinzugefügt sei und reine Gnade bedeute, die vom Ordo naturalis her nicht gefordert werden kann.
Mit der Konstruktion des rein rational zu erfassenden Ordo naturalis versuchte man, eine Argumentationsbasis zu gewinnen, auf der die Kirche ihre ethischen Positionen rein rational in den politi-schen Disput einbringen konnte. Richtig an dieser Sicht ist, dass auch nach der Erbsünde die Schöpfungsordnung zwar verwundet, aber nicht völlig zerstört ist. Das wahre Humanum zur Geltung zu bringen, wo der Anspruch des Glaubens nicht erhoben werden kann und soll, ist an sich eine angemessene Position. Sie entspricht der Selbständigkeit des Schöpfungsbereichs und der wesentlichen Freiheit des Glaubens. Insofern ist eine schöpfungstheologisch vertiefte Vision des Ordo naturalis im Anschluß an die aristotelische Staatslehre gerechtfertigt, ja, wohl notwendig. Freilich gibt es auch Gefahren:
a) Man vergisst sehr leicht die Realität der Erbsünde und kommt zu Optimismen, die naiv und nicht wirklichkeitsgerecht sind.
b) Wenn der Ordo naturalis als eine in sich komplette und des Evangeliums nicht bedürftige Ganzheit angesehen wird, besteht die Gefahr, dass das eigentlich Christliche als ein letztlich überflüssiger Überbau über das natürliche Menschsein erscheint. Tatsächlich kann ich mich erinnern, dass mir einmal der Entwurf für ein Dokument vorgelegt wurde, in dem zwar am Ende fromme Phrasen auftauchten, aber während des ganzen Argumentationsgangs nicht nur Jesus Christus und sein Evangelium, sondern auch Gott nicht vorkamen und so als überflüssig erschienen.
Man glaubte anscheinend, eine rein rationale Naturordnung konstruieren zu können, die dann aber rational doch nicht zwingend ist und andererseits das eigentlich Christliche ins bloß Sentimentale abzudrängen droht. Insofern wird hier die Grenze des Versuchs deutlich sichtbar, einen in sich geschlossenen, genügenden Ordo naturalis auszuarbeiten. P. de Lubac hat in seinem Werk „Surnaturel“ zu beweisen versucht, dass Thomas von Aquin selbst, auf den man sich dabei berief, es gerade nicht so gemeint hatte.
c) Ein wesentliches Problem eines solchen Versuchs besteht darin, dass mit dem Vergessen der Erbsündenlehre ein naives Vernunftvertrauen entsteht, das die tatsächliche Komplexität rationaler Erkenntnis im ethischen Bereich nicht wahrnimmt. Das Drama des Streits um das Naturrecht zeigt deutlich, dass die metaphysische Rationalität, die hier vorausgesetzt wird, nicht ohne weiteres einleuchtet. Mir scheint, dass der späte Kelsen recht hatte, wenn er sagte, die Ableitung eines Sollens aus dem Sein sei nur dann vernünftig, wenn ein Jemand im Sein ein Sollen hinterlegt hat.
Diese These freilich ist für ihn nicht diskussionswürdig. Insofern scheint mir doch alles letztlich am Gottesbegriff zu liegen. Wenn Gott ist, wenn ein Schöpfer ist, dann kann auch das Sein von ihm sprechen und dem Menschen ein Sollen aufzeigen. Wenn nicht, dann wird Ethos letztlich aufs Pragmatische reduziert. Deshalb habe ich in meiner Verkündigung und in meinen Schriften immer auf der Zentralität der Gottesfrage bestanden. Mir scheint, dass dies der Punkt ist, in dem die Vision Ihres Buches und mein Denken grundsätzlich übereinstimmen. Der Gedanke der Menschenrechte bleibt tragfähig letzten Endes nur, wenn er im Glauben an den Schöpfergott festgemacht ist. Von dort empfängt er seine Grenze und zugleich seine Begründung.
4. Mir kommt vor, dass Sie in Ihrem Buch „Perché dobbiamo dirci cristiani“ den Gottesgedanken der großen Liberalen anders werten als in Ihrem neuen Werk. In Ihrem neuen Opus erscheint er schon wesentlich als ein Schritt auf den Verlust des Glaubens an Gott hin. In Ihrem ersten Buch hingegen hatten Sie für mich überzeugend dargestellt, dass der europäische Liberalismus ohne den Gottesgedanken un-verständlich und unlogisch ist. Für die Väter des Liberalismus war Gott noch Grundlage ihrer Sicht von Welt und Mensch, so dass nach diesem Buch die Logik des Liberalismus gerade das Bekenntnis zu dem Gott des christlichen Glaubens notwendig macht.
Ich verstehe, dass beide Wertungen begründet sind. Einerseits löst sich im Liberalismus der Gottesbegriff von seinen biblischen Grundlagen und verliert so langsam seine konkrete Kraft. Andererseits bleibt Gott für die großen Liberalen doch noch unverzichtbar. Man kann die eine oder andere Seite des Vorgangs stärker betonen. Ich denke, man muss sie beide nennen. Aber die Vision Ihres ersten Buches bleibt für mich unverzichtbar, dass nämlich der Liberalismus seine eigene Grundlage verliert, wenn er Gott auslässt.
5. Der Gottesbegriff schließt einen Grundbegriff des Menschen als Rechtssubjekt ein, begründet und begrenzt damit zugleich die Idee der Menschenrechte. Was geschieht, wenn der Begriff der Menschenrechte vom Gottesbegriff abgelöst wird, haben Sie eindringlich und überzeugend in Ihrem Buch dargestellt. Die Multiplikation der Rechte führt letzten Endes zur Zerstörung des Rechtsbegriffs und endet in einem nihilistischen „Recht“ des Menschen, sich selbst zu verneinen – Abtreibung, Suizid, Produktion des Menschen als Sache werden zu Rechten des Menschen, die ihn zugleich verneinen. So wird in Ihrem Buch überzeugend klar, dass der vom Gottesbegriff getrennte Begriff der Menschenrechte letzten Endes nicht nur zur Marginalisierung des Christentums, sondern letztlich zu seiner Negation führt. Dieses nach meinem Dafürhalten eigentliche Anliegen Ihres Buches ist angesichts der gegenwärtigen geistigen Entwicklung des Westens, der immer mehr seine christliche Grundlage negiert und sich gegen sie kehrt, von hoher Bedeutung.
Benedikt XVI.
Quelle: kath.net Bild: Screens.