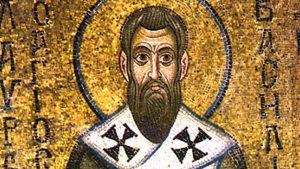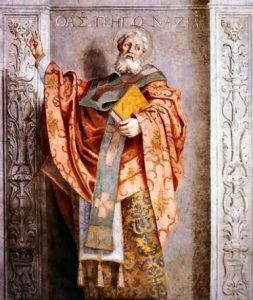Hl. Genoveva (Geneviève) – Patronin von Paris
* 422 in Nanterre in Frankreich
† 502 in Paris in Frankreich
Genoveva war das Kind armer Bauern, nach anderer Überlieferung von vornehmer Abkunft. Ihr Leben und Wirken ist völlig von Legenden überdeckt, die aber sicher einen wahren Kern haben, so ihre frühe Entscheidung für die Jungfräulichkeit, ihre Sorge für die Armen und Kranken und ihre beherzten Aktionen in Zeiten der Not. Die Legende will, dass schon bei ihrer Geburt Engel über der Wiege des neugeborenen Kindes gesungen hätten. Im Alter von sieben Jahren erlebte Genoveva in der heimatlichen Kirche in Nanterre zwei Wanderbischöfe, die – unterwegs nach England – Zwischenstation machten und predigten. Einer der beiden war Germanus von Auxerre; er erkannte in der Siebenjährigen die spätere Heilige, gab ihr – mit dem Hinweis, es statt Gold und Perlen zu tragen – ein kupfernes Medaillon mit einem Kreuz und weihte sie für ein heiliges Leben. Mit fünfzehn Jahren legte sie das Gelübde der Jungfräulichkeit ab. 16jährig ging sie, nach dem frühen Tod ihrer Eltern, zu einer Tante nach Paris und lebte im Dienst an Armen und Kranken. Vor Erschöpfung dem Tode nahe, erholte sie sich wunderbarerweise wieder und berichtete nach ihrer Genesung, Engel hätten sie bis vor Gottes Angesicht getragen.
Genovevas Gebet soll die Stadt Paris vor den Hunnen gerettet haben: Als Attila 451 gegen Paris marschierte, sammelte sie der Legende nach Frauen zum Gebet und feuerte in einer leidenschaftlichen Predigt die Männer an, Maßnahmen zur Verteidigung zu ergreifen. Doch die Geängstigten, vor allem die Männer, wollten Geneviève steinigen, ja sogar in den Fluss werfen. Die Frauen jedoch ließen sich von der Jungfrau umstimmen und knieten nieder, um mit ihr zu beten. Das Wunder geschah: die Hunnen wichen zurück und umgingen die Stadt, um sich nach Orléans zu wenden – gerade dorthin, wohin die Bevölkerung hatte fliehen wollen. In der Schlacht bei den Katalaunischen Feldern wurden dann die Asiaten besiegt.
Bei einer späteren Belagerung der Stadt durch die letzten römischen Truppen rettete Genoveva die Bevölkerung vor dem Hungertod: Es gelang ihr, so die Legende, mit Schiffen aus der Stadt zu entkommen. Mit reich beladenen Schiffen kehrte Geneviève zurück und konnte allen das Notwendige austeilen. Zur Verbreitung des Christentums soll sie beigetragen haben, indem sie Chlodwig I., den Herrscher der Franken, und mit ihm das gesamte Volk, bekehrte.
Ihre große Nächstenliebe wirkte nach den Legenden viele Heilungen und hilfreiche Taten: Genoveva rettete einen vierjährigen Knaben aus einem Brunnen; mit ihrem Pallium, das sie über ihn warf, erwachte er zum Leben. Beim Bau der Kirche von St-Denis ging den Bauleuten das Getränk aus, sie ließ den Kelch holen, der sich auf ihr Gebet hin füllte und gefüllt blieb, bis der Bau vollendet war. Eine Kerze hatte ihr ein Teufel ausgeblasen, ein Engel aber wieder angezündet; auch wenn Kerzen beim Kirchgang oder in ihrer Kammer erloschen, entzündeten sie sich wieder, wenn Genoveva sie in die Hand nahm. Partikel ihrer Kerzen bewirkten Heilungen. Als der Merowinger Childerich die Stadttore schließen ließ, damit Genoveva die Gefangenen nicht befreie, eilte sie herbei, die Tore öffneten sich von selbst, und die Schlüssel blieben in ihrer Hand.
Genoveva wurde in der späteren Abteikirche Église de Sainte-Geneviève begraben. Auch nach ihrem Tode ereigneten sich noch zahlreiche Wunder an ihrer Grabstätte. Als im Jahre 1129 in Frankreich eine bislang unbekannte Fieberkrankheit auftrat, bei welcher menschliche Heilkunst versagte, wandte man sich an die Schutzheilige um Fürsprache, und angeblich wurden alle, die gläubig ihre Reliquien berührten, geheilt. Ludwig XV. ließ ihr zu Ehren 1764 eine neue Kirche errichten, die 1791 von der Konstituierenden Versammlung benutzt und im Zuge der Französischen Revolution zum Panthéon umgebaut wurde, der Totengedenkstätte für hochrangige französische Persönlichkeiten.
Quelle: CFM.SCJ Archiv Cairo