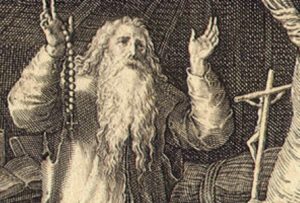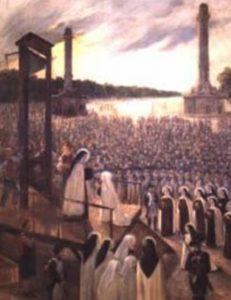Kardinal Müller: „Gott steht über allem Geschaffenen“
(Rom) „Die Amazonassynode ist ein Vorwand, um die Kirche zu verändern, und die Tatsache, dass sie in Rom stattfindet, will den Beginn einer neuen Kirche unterstreichen.“ Mit diesen Worten kritisiert Kardinal Gerhard Müller die bevorstehende Sondersynode über das Amazonas-Tiefland, dessen Agenda dunkle Schatten vorauswirft. Der ehemalige Glaubenspräfekt bestätigt die Befürchtung, dass die von Papst Franziskus für kommenden Oktober einberufene Synode eine „andere Kirche“ zum Ziel hat.
Vor Kardinal Müller hatte bereits Kardinal Walter Brandmüller ein vernichtendes Urteil über das Instrumentum laboris, das Arbeitsdokument der Amazonassynode gefällt, das Grundlage der Synode sein wird. Das Arbeitsdokument wurde von Papst Franziskus genehmigt und entspricht somit seinem Willen.
Auch andere katholische Persönlichkeiten und Medien haben die Synodenväter, deren genaue Zusammensetzung noch nicht bekannt ist, bereits aufgerufen, das Arbeitsdokument abzulehnen.
Riccardo Cascioli, der Chefredakteur der katholischen Online-Tageszeitung La Nuova Bussola Quotidiana (NBQ), veröffentlichte gestern dazu ein Interview mit Kardinal Müller.
Cascioli: Eminenz, Sie sagen: „Sie wollen die Kirche verändern“, welches sind die klaren Signale eines solchen Willens?
Kardinal Müller: Der Ansatz des Instrumentum laboris ist eine ideologische Sichtweise, die keinen direkten Zusammenhang mit dem theologischen Ansatz zur Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort, wahrer Gott und wahrer Mensch, hat. Sie wollen die Welt retten, aber nach ihren Vorstellungen, indem sie vielleicht einige Elemente der Heiligen Schrift und der apostolischen Tradition verwenden. Nicht von ungefähr findet sich darin, obwohl von Offenbarung, Schöpfung, Sakramenten und dem Verhältnis zur Welt die Rede ist, fast kein substantieller Bezug zu den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, die diese Aspekte definieren. Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Man redet nicht von der Wurzel der Menschenwürde, der Universalität des Heils, der Kirche als universales Sakrament der Rettung der Welt. Es finden sich nur profane Ideen, über die man auch diskutieren kann, aber sie haben nichts mit der Offenbarung zu tun.
Cascioli: In diesem Zusammenhang scheint mir wichtig, die Nr. 39 des Instrumentum laboris zu erwähnen, wo von einem „großen und notwendigen Bereich des Dialogs zwischen den Spiritualitäten, den Bekenntnissen und den Religionen des Amazonas“ die Rede ist, was „eine freundschaftliche Annäherung der verschiedenen Kulturen verlangt“. Und es heißt weiter: „Die nicht ehrliche Öffnung gegenüber dem Anderen sowie eine korporative Haltung, die das Heil exklusiv dem eigenen Credo vorbehält, sind destruktiv, selbst für das eigene Credo.“
Kardinal Müller: Sie behandeln unser Credo, als handle es sich dabei um unsere europäische Meinung. Das Credo ist aber die vom Heiligen Geist erleuchtete Antwort auf die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, der in der Kirche lebt. Es gibt kein anderes Credo. Es gibt hingegen andere philosophische Überzeugungen oder mythologische Ausdrucksformen, aber niemand hat je zu sagen gewagt, dass beispielsweise die Weisheit des Platon eine Offenbarung Gottes ist. In der erschaffenen Welt manifestiert Gott nur seine Existenz, sein Sein als Bezugspunkt des Gewissens, des Naturrechts, aber es gibt keine andere Offenbarung außer die von Jesus Christus. Das Verständnis von Lógos spermatikòs (die „Samen des Wortes“), vom Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegriffen, bedeutet nicht, dass die Offenbarung Jesu Christi in allen Kulturen unabhängig von Jesus Christus existiert, so als sei Jesus nur eines dieser Elemente der Offenbarung. Der heilige Justinus der Märtyrer lehnte alle heidnischen Mythologien ab und sagte, dass die Elemente der Wahrheit in den Philosophien Eigentum Christi sind (II Apol. 13), in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind (Col 2,3).
Cascioli: Also stimmen Sie mit Kardinal Brandmüller überein, wenn dieser im Zusammenhang mit diesem Dokument von „Häresie“ spricht?
Kardinal Müller: Häresie? Nicht nur, es ist auch ein Mangel an theologischer Reflexion. Der Häretiker kennt die katholische Glaubenslehre und widerspricht ihr. Hier aber macht man nur eine große Verwirrung, und das Zentrum von allem ist nicht Jesus Christus, sondern sind sie selbst und ihre menschlichen Ideen zur Rettung der Welt.
Cascioli: Im Dokument wird als Modell der ganzheitlichen Ökologie die „Kosmovision“ der indigenen Völker vertreten, die eine Konzeption sei, laut der Geister und Gottheiten „mit und im Territorium mit der Natur und im Verhältnis zu dieser wirken“. Und sie wird mit dem „Mantra von Franziskus: ‚Alles ist miteinander verbunden‘“ (Nr. 25) in Zusammenhang gebracht.
Kardinal Müller: Die „Kosmovision“ ist eine pan-naturalistische oder – im modernen, europäischen Kontext – eine materialistische Konzeption, die jener des Marxismus ähnelt: Am Ende können wir tun, was wir wollen. Gott ist nicht die Natur, wie es Baruch de Spinoza (1632–1677) formulierte. Wir aber glauben an Gott, den Schöpfer des Universums. Die Schöpfung existiert für die Verherrlichung Gottes, aber sie ist auch eine Herausforderung für uns, die wir gerufen sind, mit dem heilbringenden Willen Gottes für alle Menschen zusammenzuarbeiten. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Natur zu bewahren, so wie sie ist. Wir haben vielmehr die Verantwortung für den Fortschritt der Menschheit in der Erziehung, der sozialen Gerechtigkeit, für den Frieden zwischen den Völkern. Deshalb bauen die Katholiken Schulen und Krankenhäuser, denn auch das ist Teil der Mission der Kirche. Man kann nicht die Natur idealisieren, als wäre der Amazonas eine Art Paradies, denn die Natur ist nicht immer freundlich gegenüber dem Menschen. Im Amazonas gibt es wilde Tiere, Infektionen, Krankheiten. Und auch die dortigen Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf eine gute Ausbildung und den Zugang zu einer modernen Medizin. Man kann nicht nur die traditionelle Medizin idealisieren, wie es in diesem Synodendokument geschieht. Eine Sache ist es, Kopfschmerzen zu behandeln, eine andere Sache ist es aber, wenn es um ernste Krankheiten und komplizierte Operationen geht. Der Mensch hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, alles zu tun, die Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Auch das Konzil wertet die moderne Wissenschaft auf, weil wir dank ihr viele Krankheiten besiegt, die Kindersterblichkeitsrate gesenkt und die Gefahren für die Mütter reduziert haben. Die moderne Technik ist ja nicht an sich des Teufels, hat aber dazu zu dienen, die vielen Probleme der menschlichen Existenz zu lösen. Die Christen haben eine Verantwortung für die Förderung des zeitlichen Allgemeinwohls (Gaudium et Spes, 34ff), ohne es aber mit dem ewigen Heil zu verwechseln.
Cascioli: Die traditionellen Kulturen und Religionen der indigenen Amazonasvölker werden aber als Modell der Harmonie mit der Natur beschrieben.
Kardinal Müller: Seit der Ursünde gibt es keine Harmonie mehr mit der Natur. Oft ist sie der Feind des Menschen, in jedem Fall aber ist sie ambivalent. Denken wir an die vier Elemente: Erde, Feuer, Wasser und Luft. Erdbeben, Brände, Überschwemmungen, Stürme sind alles Ausdrucksformen der Natur und Gefahren für den Menschen. Der Mensch seinerseits ist zum Feind seines Bruders geworden anstatt sein Freund zu sein (Ehebruch, Raub, Lüge, Mord, Krieg). „Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden“ (Röm 8,22–23).
Cascioli: Alles wird mit dem Schlüssel einer verpflichtenden „ökologischen Umkehr“ gelesen…
Kardinal Müller: Wir müssen auf absolute Weise Begriffe wie „ökologische Umkehr“ ablehnen. Es gibt nur die Umkehr zum Herrn, und als Konsequenz gibt es auch das Wohl der Natur. Wir können nicht aus dem Ökologismus eine neue Religion machen. Da sind wir bei einem pantheistischen Verständnis, das abzulehnen ist. Der Pantheismus ist nicht nur eine Theorie über Gott, sondern auch Verachtung des Menschen. Der Gott, der mit der Natur gleichgesetzt wird, ist keine Person. Der Schöpfergott aber hat uns nach Seinem Ebenbild erschaffen. Im Gebet haben wir eine Beziehung zu Gott, der uns zuhört, der versteht, was wir brauchen, und nicht einen Mystizismus, in dem wir die persönliche Identität auflösen können. „Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,15).
Cascioli: Und man soll die „Mutter Erde“ achten.
Kardinal Müller: Unsere Mutter ist eine Person und nicht die Erde. Und unsere Mutter im Glauben ist Maria. Auch die Kirche ist als Mutter beschrieben, da sie Braut Jesu Christi ist. Diese Worte dürfen nicht inflationär gebraucht werden. Eine Sache ist es, Respekt für alle Elemente dieser Welt zu haben, ein ganz andere, sie zu idealisieren und zu vergöttern. Diese Gleichsetzung Gottes mit der Natur ist eine Form von Atheismus, weil Gott von der Natur unabhängig ist. Sie [die Autoren] ignorieren völlig die Schöpfung.
Cascioli: Bereits zu Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts sah der damalige Kardinal Ratzinger, dass in den Kirchen nicht mehr über die Schöpfung gepredigt wurde, und er sah die dramatischen Konsequenzen voraus.
Kardinal Müller: In der Tat entstehen alle diese Irrtümer wegen der Verwirrung zu Schöpfer und Geschöpf, wegen der Gleichsetzung Gottes mit der Natur, was unter anderem den Polytheismus hervorbringt, weil jedem Naturelement eine Gottheit zugeschrieben wird. Gott aber ist nicht Teil seines Werkes. Er ist souverän und steht über allen geschaffenen Dingen. Das ist keine Verachtung, sondern Hochachtung der Natur. Ein grundlegendes Axiom der katholischen Theologie sagt: Gratia non tollit naturam sed perficit eam (Thomas von Aquin, Summa theologiae I, q. 1 a.8). Und die Menschen sind nicht mehr Sklaven der Elemente, sie müssen nicht mehr den Gott des Feuers anbeten oder dem Feuergott Opfer bringen, um uns mit einem Element zu versöhnen, das uns angst macht. Der Mensch ist endlich frei.
Cascioli: In dieser pantheistischen Sichtweise, die sich das Instrumentum laboris zu eigen macht, ist auch eine Kritik am Anthropozentrismus zu erkennen, den die Kirche korrigieren solle.
Kardinal Müller: Es ist eine absurde Idee, behaupten zu wollen, dass Gott nicht anthropozentrisch sei. Der Mensch ist der Mittelpunkt der Schöpfung, und Jesus ist Mensch geworden. Er ist nicht eine Pflanze geworden. Das ist eine Häresie gegen die Menschenwürde. Die Kirche muss vielmehr den Anthropozentrismus betonen. Das Leben des Menschen ist unendlich würdiger als das Leben egal welchen Tieres. Heute gibt es bereits einen Umsturz dieses Prinzips: Wenn ein Löwe in Afrika getötet wird, ist das ein weltweites Drama, wenn aber hier die Kinder im Mutterleib getötet werden, ist das in Ordnung. Auch Stalin behauptete, dass diese Zentralität der Menschenwürde zu beseitigen sei; so konnte er viele Menschen rufen, um einen Kanal zu graben und sie zum Wohl der künftigen Generationen sterben zu lassen. Dafür nützen diese Ideologien, damit einige über alle anderen herrschen können. Gott aber ist anthropozentrisch, die Menschwerdung ist anthropozentrisch. Die Ablehnung des Anthropozentrismus rührt von einem Hass her auf sich selbst und auf die anderen Menschen. Der Mensch in Christus als Sohn des Vaters ist theozentrisch, aber nie kosmozentrisch. Die Liebe zu Gott über alles und die Liebe zum Nächsten, das ist das Gravitationsfeld der menschlichen Existenz.
Cascioli: Ein anderes magisches Wort von Instrumentum laboris ist die Inkulturation, die mehrfach mit der Inkarnation in Verbindung gebracht wird.
Kardinal Müller: Die Inkarnation fast als Synonym für Inkulturation zu gebrauchen, ist die erste Mystifizierung. Die Menschwerdung ist ein einmaliges, unwiederholbares Ereignis. Es ist das Wort, das sich in Jesus Christus inkarniert. Gott hat sich nicht in der jüdischen Religion inkarniert, er hat sich nicht in Jerusalem inkarniert; Jesus Christus ist einzigartig. Das ist ein grundlegender Punkt, weil die Sakramente von der Inkarnation abhängen. Sie sind Gegenwart des fleischgewordenen Wortes. Man darf bestimmte Begriffe nicht missbrauchen, die im Christentum von zentraler Bedeutung sind. Die Kirche drückt sich in den Symbolen der Katechese und in der sekundären Liturgie in den Formen der verschiedenen Kulturen aus. Die sakramentalen Symbole (Wort und Zeichen) aber führen die übernatürliche Gnade des gegenwärtigen Christus aus. Deshalb darf man die Liturgie nicht verachten als „ein Museumsstück oder Besitz von wenigen“ (Nr. 124). Die „Substanz der Sakramente“ ist wichtiger als die sekundären Riten und kann nicht durch die kirchliche Autorität geändert werden (Konzil von Trient, 21. Sess., 1562, DH 1728).
Cascioli: Kehren wir zur Inkulturation zurück: Aus dem Synodendokument geht hervor, dass alle Glaubensformen der indigenen Völker, ihre Riten und ihre Gebräuche anzunehmen sind. Man findet sogar einen Bezug, wie sich das frühe Christentum in die griechische Welt inkulturiert hat. Und es heißt, so wie man es damals gemacht hat, so muss man es heute mit dem Volk des Amazonas machen.
Kardinal Müller: Die katholische Kirche hat aber nie die griechischen und römischen Mythen akzeptiert. Im Gegenteil: Sie hat eine Gesellschaft abgelehnt, die mit der Sklaverei die Menschen verachtete. Sie hat die imperialistische Kultur Roms abgelehnt und die Päderastie, die für die Griechen typisch war. Die Kirche hat sich auf das Denken der griechischen Kultur bezogen, das soweit gelangt war, Elemente zu erkennen, die dem Christentum über den Verstand den Weg öffneten. Das Verhältnis zwischen geoffenbartem Glauben und menschlichem Intellekt ist die Basis unserer Beziehung zu Gott, Ursprung und Ende der ganzen Schöpfung. Aristoteles hat nicht die zehn Kategorien erfunden: Sie existieren bereits im Sein; er hat sie entdeckt. So wie es in der modernen Wissenschaft geschieht. Das betrifft nicht nur den Westen, es ist vielmehr die Entdeckung einiger Strukturen und Mechanismen, die in der Natur vorhanden sind. Dasselbe gilt für das Römische Recht, das nicht irgendein willkürliches System ist. Es ist vielmehr die Entdeckung einiger Rechtsgrundsätze, die die Römer in der Natur einer Gemeinschaft gefunden haben. Mit Sicherheit haben andere Kulturen nicht eine solche Tiefe erreicht, aber wir leben dennoch nicht in der griechischen, römischen, gotischen, langobardischen oder fränkischen Kultur. Das Christentum hat die griechische und römische Kultur völlig verändert. Bestimmte heidnische Mythen können eine pädagogische Dimension haben, die zum Christentum hinführen, aber sie sind keine Elemente, auf denen das Christentum gründet.
Cascioli: In diesem Prozess der Inkulturation, werden durch das Instrumentum laboris auch die Sakramente neu gelesen, vor allem was die heiligen Weihen betrifft mit dem Vorwand, dass es in einem so großen Gebiet zu wenig Priester gibt.
Kardinal Müller: Und hier zeigt sich wiederum, dass der zugrunde liegende Ansatz soziologisch und nicht theologisch ist. Die Offenbarung Gottes in Christus ist in den Sakramenten gegenwärtig, und die Kirche besitzt keine Autorität, die Substanz der Sakramente zu ändern. Sie sind keine Riten, die uns gefallen, und das Priestertum ist keine soziologische Kategorie, um eine Beziehung in der Gemeinschaft herzustellen. Jedes kulturelle System hat seine Riten und seine Symbole, aber die Sakramente sind göttliche Gnadenmittel für alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten. Deshalb können wir weder den Inhalt noch die Substanz ändern. Und wir können auch nicht den Ritus ändern, wenn dieser Ritus von Christus selbst konstituiert ist. Wir können die Taufe nicht mit irgendeiner Flüssigkeit vollziehen, sondern mit Naturwasser. Beim Letzten Abendmahl hat Jesus Christus nicht irgendein Getränk oder irgendeine Speise genommen. Er hat Wein von Trauben und Weizenbrot genommen. Einige sagen: Aber der Weizen wächst im Amazonas nicht, nehmen wir etwas anderes. Das ist aber nicht Inkulturation. Sie wollen nicht nur das ändern, was kirchliches Recht ist, sondern auch was göttliches Recht ist.
Cascioli: Eminenz, eine letzte Sache: Sie beziehen sich immer wieder auf „sie“, die die Kirche ändern wollen. Wer aber sind diese „sie“?
Kardinal Müller: Das hängt nicht von einer Person oder einer bestimmten Gruppe von Personen ab. Es ist ein System der Selbstbezogenheit, das gegen jedes kritische Argument immun ist. Ein Denken, das a priori andere katholische Gläubige und Theologen diskreditieren muss, indem sie moralisch als Pharisäer, Gesetzeslehrer, Hartherzige und Konservative abgestempelt werden. Man spricht voll Respekt von der Weisheit der Ahnen, verachtet aber die lange Tradition der Kirche. Die Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. werden wie etwas Überholtes behandelt. Man will sich der Welt anpassen: unauflösliche Ehe, Zölibat, Priesterinnen, die apostolische Autorität, sie werden behandelt, als handle es sich um ein politisches Problem. Alles muss in der Überzeugung geändert werden, dass es dadurch zu einem neuen Frühling der Kirche, zu einem neuen Pfingsten kommt. Auch das ist eine bizarre Idee, da die Ausgießung des Heiligen Geistes ein einmaliges, eschatologisches Ereignis ist, das für immer gilt. Als würde das Beispiel der Protestanten nicht genügen, um diese Illusion zu widerlegen. Sie sehen nicht, dass sie die Kirche zerstören. Sie sind wie Blinde, die in die Grube fallen. Die Kirche hat sich gemäß den Grundsätzen der katholischen Theologie und nicht der Soziologie oder des Naturalismus und Positivismus zu entfalten, (vgl. Dei Verbum, 8-10). „Die heilige Theologie ruht auf dem geschriebenen Wort Gottes, zusammen mit der Heiligen Überlieferung, wie auf einem bleibenden Fundament“ (Dei Verbum, 24).
Quelle: katholisches.info Bild: CFM.SCJ Archiv Alexandria